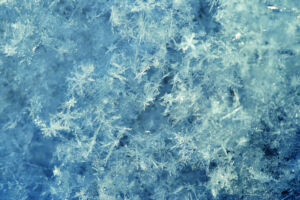CultCryo – Infrastruktur, Politik und Zukunftsperspektiven künstlicher Kühlung
Künstliche Kühlung prägt die Welt, in der wir leben, grundlegend. Kühl- und Gefriertechnologien sind für eine Vielzahl von Alltagspraktiken unentbehrlich geworden. Das Projekt erforscht die kulturellen Grundlagen der globalen Kälteinfrastruktur und deren Auswirkungen.